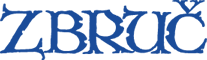Erzählung eines Arrestanten [Fragment]
I
Die gelehrten Naturforscher wissen von einem „toten Wasser“ zu erzählen. Es sind diejenigen Wasserschichten, welche den Boden der tiefsten Meerestiefen bedecken. Die ungeheuere Wassersäule, welche auf jedem Teilchen jenes Bodenwassers lastet, benimmt demselben jegliche Bewegung, jegliches Leben. Das Sonnenlicht dringt dort nicht hinab, kein Lebewesen kann dort gedeihen, keine Wasserströmung, keine Stürme, keine Erdbeben sind dort sei es auch durch das leiseste Zittern fühlbar. Die einzige Bewegung, die sich hier bemerkbar macht, ist das ewige und unaufhörliche Hinabsinken der Millionen von Leichen und Skelette lebendiger Wesen, welche einst, oft auch in ziemlich entfernten Zeitpunkten, dort oben gelebt und sich getummelt, im Sonnenschein geprangt, in der Wärme gebadet, sich, auf mächtigen Meereswellen geschaukelt haben. Sie starben und begannen langsam, langsam hinabzusinken, besonders jene winzigen Foraminiferen, Diatomeen und anderes Kleinzeug, welches die Hauptmasse des Meereslebens ausmacht. Langsam drangen ihre Leichen durch die immer dichteren, an Sauerstoff und Kohlensäure reicheren Wasserschichten, versetzen sich, verbrennen gleichsam unterwegs, um erst mit der Zeit als mikroskopische Kügelchen und Fragmente den Boden zu erreichen, dieses große Totenfeld, wo sie ihr Grab finden, um einst, nach Jahrtausenden, einen Kreidefels zu bilden.
Es muß doch für jene untersten Wasserschichten schwer und traurig sein, ewig an jenem dumpfen Totenfelde zu kleben und zu erstarren, in dunkelster Finsternis, unter ungeheuerem Drucke, in der einzigen und ausschließlichen Nachbarschaft von Leichen. Schwer und traurig muß es für sie sein, besonders [da] in ihnen insgeheim jene ewige, unzerstörbare Kraft sich regt, ohne welche es in der Natur kein einziges Atom gibt. Die lebendige, unzerstörbare Kraft im Inneren und ringsum Dunkelheit, schrecklicher Druck und unendliches Totenfeld! Und wenn sich in diesen unglücklichen, zur ewigen Totenstarre verurteilten Atomen einmal in einem Jahrtausend ein leises Gedankenzittern regt — denkt ihr, es sei unmöglich? Ist ja doch auch unser denkendes Gehirn nichts anderes als eine Zusammensetzung derselben Atome von Sauerstoff, Kohlenstoff und anderer Elemente, so muß es ein trauriger, bitterer Gedanke, ein trauriges Träumen sein.
Mutter Natur! Warum bist du gegen uns so ungerecht? Sind wir denn schlechter als jene, welche dort oben über uns sich tummeln, sich schaukeln und im wunderbaren Sonnenlichte prangen? Und könntest du nicht eine Reihenfolge einsetzen, könntest du uns nicht dorthin, nach oben, wenn, auch nur für einen Augenblick emporheben?
Allein die Mutter Natur kennt keine Sentimentalität und kehrt sich nicht an Träume.
Was hab’ ich mit euch Narren zu schaffen? brummt sie. Fühlt ihr Kraft in euch, so versucht nur selbst emporzukommen! Das fehlte noch, daß ich euch helfen soll! Jemand muß doch dort unten sein und wer es ist, das ist doch für mich ganz gleichgültig.
Ja! Versucht nur emporzukommen!
Ist es euch nicht vorgekommen, auch im Menschenleben ähnliche Vorkommnisse zu beobachten? Ach, nur zu oft, meine Lieben, müßt ihr sie beobachtet haben. Und ein jedes solches Vorkommnis gab euch einen Stich ins Herz, und auch jetzt noch fühlt ihr gewiß jenen Stich, sooft ihr es versucht, euch in Gedanken in die Lage jener armen lebendigen Atome der menschlichen Gesellschaft zu versetzen, jenes Bodensatzes, welchen ein neidisches Geschick zur ewigen Finsternis, zur stumpfen Unbeweglichkeit, zum unmerklichen Tode verdammt hat. Sind wir doch alle, wir Ruthenen, auch eine solche Bodenschicht unter den Nationen. Jede kräftige, gesunde Bewegung freier und glücklicher Völker fühlen wir nur als dumpfen Schmerz, als Druck, als Stöße an unseren Volksorganismus ... Und ein jeder von uns, der, manchmals nach unendlichen Mühen, nach Aufopferung so manchen Daseins unserer Nächsten und Liebsten, sich von diesem dunklen Abgrunde auch nur ein wenig höher emporkämpfte, fühlt er denn nicht oft ein unwillkürliches Grauen und Schaudern bei dem bloßen Gedanken an jenen Abgrund und auch daran, daß er selbst, wenn nicht dieser oder jener glückliche Zufall eingetreten wäre, vielleicht für immer dort steckengeblieben wäre, dumpf, hilflos, von niemandem gekannt, nicht Mensch, sondern ein Teil der menschlichen Masse? Und zuckt denn nicht unser Herz vor Weh bei dem Gedanken an die Tausende und Abertausende solcher, welche ebenso wie wir sich bemüht haben, um aus dieser Finsternis emporzuklimmen, welche zum Licht sich gesehnt, zur Wärme und Freiheit sich gedrängt haben — und alles umsonst? Und läuft nicht ein Schaudern des Entsetzens über unsere Nerven weg, wenn wir an das Leben und an das Ende solcher niemandem bekannter, vergessener, oft in den Kot getretener und bespieener Unglücklicher denken, wenn es uns klar wird vor den Augen, daß manchmals lediglich ein ganz stupider Umstand, ein blinder Zufall, ein Mißverständnis, ein Scherz, ein unabsichtliches Wort, ein Stäubchen sie von ihrem mühevollen Pfade abstoßen und für immer in jene Finsternis zurückgeschleudert hat, aus welcher sie schon bald ins Freie emporzukommen hofften?
Solche Gedanken fraßen mein Gehirn und verscheuchten den Schlaf von meinen Augenlidern der langen, langen Nächte und Tage, die ich im Gefängnis durchlebte. Meine Leidensgefährten, von denen jeder auch im eigenen Innern einen nie schlafenden Wurm nagen fühlte, konnten keine Trostesworte für mich finden; im Gegenteil, ich sah, daß sie selbst nur zu oft weit mehr als ich so eines heilsamen Wortes benötigten. Um unter solchem Leidensdruck nicht wahnsinnig zu werden, sprachen wir miteinander, erzählten uns — nicht von sich selbst, sondern von anderen, Fernen —, und das waren auch fast immer Leidensgeschichten. Eine solche Erzählung, welche sich tiefer als die anderen in mein Gedächtnis eingegraben hat, will ich hier wiedergeben. Derjenige, welcher sie erzählte, war — über sein „Fach“ will ich kein Wort verlieren — noch ein junger Bursche, voller Kraft und Mut, nicht ohne gutes, menschlich warmes Gefühl. Er hatte eine städtische Erziehung genossen, eine Volksschule absolviert, ein Handwerk gelernt, mit einem Wort: hatte auch nicht wenig Kraft und Aufwand hingeopfert, um nach oben emporzuklimmen, ein menschliches Dasein sich zu erkämpfen — und doch wurde er ... Doch schweigen wir lieber davon!
Schon das sechstemal saß er hinter Schloß und Riegel und wußte alle Arrestantenstückchen, kannte, wie er sich selbst ausdrückte, „die allgemeine Geschichte einer jeden Gefängniszelle“. Die Gefangenwärter betrachteten ihn als einen unruhigen Störefried und ließen es ihm auch durch häufige Disziplinarstrafen merken. Er ließ sich aber dadurch nicht einschüchtern und explodierte wie Schießpulver, sobald er nur [davon hörte], daß etwas Ungehöriges geschah, daß man den Arrestanten irgendwie nahetrat. Besonders oft kam es zu Reibereien zwischen ihm und der Schildwache, welche unter unserem Fenster auf- und abging und Obacht geben sollte, daß die Arrestanten nicht zum Fenster hinausschauen und von Zelle zu Zelle nicht miteinander sprechen. Etliche Male drohte ihm der Soldat mit dem Schießen, wenn er vom Fenster nicht weggehe, er aber saß ruhig da ohne ein Wort zu sagen, und erst als der Soldat das Gewehr emporhob und den Hahn aufknackte, sprang er vom Fenstergesimse herab und rief:
,,Na, na! Ich weiß doch, daß du nicht schießen darfst.“
„Woher weißt du denn das?“ fragte ich einmal.
„Eis ist ihnen verboten. Ich weiß es. Ich war ja selbst dabei und sah das Faktum.“ „Was für ein Faktum?“
„Das Faktum, dessentwegen es den Schildwachen verboten wurde, auf die Arrestanten im Fenster zu schießen. Früher hatten sie eine strenge Weisung. Jetzt können sie nur drohen, schießen aber dürfen sie nicht.“
„Was für ein Faktum war es denn?“
„Ah, es ist eine ganze Geschichte. Meinetwegen, ich will sie lieber erzählen als dort am Fenster dem armen Rekruten da unten Gewissensbisse verursachen. Der arme Teufel kann ja nichts dafür: Was man ihm befiehlt, das muß er tun.“
II
Vor zwei Jahren war’s — so begann er —, ganz richtig, zwei Jahre werden bald vorüber sein. Ich saß damals in dieser Hölle in Untersuchungshaft. In dieser Zelle waren wir nur zwei, ich und ein älterer Herr, Žurkcovśkyj hieß er. Was er eigentlich war und was ihn hierher gebracht hatte, ist schon meiner Erinnerung entschwunden.
Da geschah es an einem Abend — es war schon nach der Abendvisite, wir hatten uns schon entkleidet und schlafen gelegt —, da hörten wir plötzlich Schritte des Beschließers und lautes Knirschen der Schlüssel in den Vorhängeschlössern. Endlich machte er die Tür von unserer Zelle auf, eine gelbliche Lichtgarbe von seiner Laterne fiel herein, und von diesem Licht beschienen, sahen wir eine gekrümmte, halb nackte, magere Figur. Der Beschließer stieß dieselbe vor sich hin und in die Zelle herein, da sie selbst offenbar es nicht vermochte, sich mit gehöriger Raschheit zu bewegen.
„Da hast du eine Decke und ein Leintuch“, schrie der Beschließer und warf die genannten Gegenstände der Figur an den Kopf, wodurch sie fast bis an den Boden gebeugt wurde. „Leg dich hin und schlaf! Eßzeug bekommst du morgen.“
Nach diesen Worten schloß er die Tür zu und ging weg. In der Zelle wurde es dunkel wie in einem Keller und still wie im Grabe. Nur von Zeit zu Zeit hören wir ein dumpfes Geklapper, als ob eine Köchin hinter der Wand auf dem Tische mit Hackmessern Fleisch hackte. Es war aber unser neuer Genosse, welcher so mit Zähnen klapperte. Es war ja schon Spätherbst, zwei Wochen nach Allerheiligen und bitterkalt.
„Wer bist du?“ frage ich den Zähneklappernden ohne mich vom Bette zu erheben. Ich wurde schon warm unter meiner Decke und wollte nicht auf stehen; in der Zelle aber war es ziemlich kalt, denn das Fenster mußte aus Ventilationsrücksichten Tag und Nacht offen bleiben.
Der neue Genosse schweigt, klappert noch stärker mit den Zähnen, und durch dieses Geklapper hört man nur abgerissenes Schluchzen. Es tat mir leid um den Burschen, denn ich hatte gleich bemerkt, daß es ein noch ganz grüner „Freier“ sein muß. Ich erhob mich also und machte ihm tappend das Bett auf einer leerstehenden Pritsche.
„Na, na“, sag’ ich, „sei nur still, weine nicht! Zieh dich aus und lege dich schlafen.“ „Ich ... ich .. ka ... kann nicht“, vermochte er kaum herauszustottern. „Warum nicht?“
„Ich ... ich ... bi ... bin ... ga ... ganz starr vo .. vor Kälte.“
Gott im Himmel! Ich betastete ihn, und er ist so erstarrt vor Kälte, daß er weder Hand noch Fuß bewegen kann. Durch welches Wunder er in die Zelle hereinzukommen vermocht hatte, versteh’ ich nicht. Auch der Herr stand auf, wir nahmen ihm seine Lumpenkleider ab, zogen ihn ganz nackt aus, rieben ihn tüchtig ein, wickelten [ihn] in das Leintuch und dann in die Decke ein und legten ihn auf die Pritsche. Es mochte eine Viertelstunde vergangen sein, da hör’ ich, daß er sich rührt.
„Na, wie fühlst du dich jetzt?“ fragte ich.
„Etwas besser.“
„Sind schon Hände und Füße warm?“
„Noch nicht ganz, aber immerhin, besser ist’s.“
„Woher bist du?“
„Von Smerekow.“
„Also hat dich ein Gendarm hiehergebracht?“
„Ganz richtig. Er führte mich heute von früh bis zum Spätabend in dieser Kälte, und ich war fast nackt und barfuß. Zehnmal fiel ich unterwegs um und konnte nicht gehen. Der Gendarm aber schlug mich mit einem Riemen so lange, bis ich wieder vorwärtskam. Erst in Zboiska ruhten wir im Wirtshause ein wenig aus, und der dortige Jude gab mir ein Glas Schnaps.
„Wie heißt du denn?“
„Josel Stern.“
„Ah! Bist du denn ein Jude?“
„Ganz richtig, ich bin ein Jude.“
„Der Teufel soll dich holen! Totschlägen soll man mich, wenn ich an deinem Gespräch erkannt hätte, daß du ein Jude bist, so rein sprichst du ruthenisch.“ „Wundert euch nicht, Herr! Ich wuchs ja im Dorfe auf, unter Bauern. Ich war sogar Gemeindehirt.“
„Und wie alt bist du?“
„Sechzehn Jahre.“
„Was hast dudenn verbrochen, daß man dich bis hieher ins Kriminal gebracht hat ? “
„Ach, Herr, ich weiß es selbst nicht. Der Gendarm sagte mir, mein Dienstherr hätte mich wegen Raub und Einbruch angeklagt, aber Gott strafe mich, wenn ich etwas geraubt habe. Nur meine Papiere, meiner Seel’, nur meine Papiere!“
Und er begann zu schluchzen und zu weinen wie ein Kind.
„Na, na, sei nur still, du Narr!“ sage ich ihm. „Morgen wirst du das dem Richter sagen, mich geht das gar nichts an. Schlafe jetzt!“
„Ach, Herr! Der Gendarm sagte aber, man werde mich dafür hängen!“ klagt Josel.
„Bist du von Sinnen, du Narr!“ schrie ich. „Lach ihn aus! Wo hat man das gehört, daß jemand wegen solcher Dummheit gehängt worden wäre?“
„Und mein Dienstherr sagte, daß er mich wenigstens auf zehn Jahre ins Kriminal einpacken wird.“
„Na, na, mache dir nichts daraus!“ sage ich. „Gott ist barmherzig, es wird sich noch alles schlichten lassen. Schlafe nur jetzt, morgen bei Tageslicht werden wir die Sache besser besprechen.“
Wir schwiegen und schlief[en] bald ein. Das ist mein ganzes Glück im Kriminal, daß ich schlafe wie der Hase im Kohl.
III
Erst am anderen Tage konnten wir unseren Neuling gut betrachten. Ich mußte über mich selbst laut auflachen, wie es nur möglich war, daß ich ihn gestern gleich beim ersten Schritt nicht als Juden erkannt hatte. Rothaarig, mit Stirnlocken, die Nase gebogen wie eines alten Geiers Schnabel, die Haltung gebeugt, wenn er auch für seine Jahre gar nicht schmächtig und gut gewachsen war. Wenn man ihn nur ansah, so schien es, daß er auf zehn Schritte um sich herum einen speziellen Judengeruch verbreite. Gestern aber, als wir ihn im Dunkeln einrieben und nur seine Worte hörten, spürten wir gar nichts von diesem Geruch.
Auch er begann ängstlich in der Zelle umherzublicken wie ein aufgescheuchtes Eichhörnchen. Er stand auf, als ich und Herr Žurkovśkyj noch schliefen, wusch sich, legte sein Bettzeug zusammen und setzte sich darauf in der Ecke und saß so mäuschenstill wie versteinert.
„He da, bist du hungrig?“ fragte ich ihn.
Er schwieg, seine ganze Gestalt bückte sich noch mehr zusammen.
„Hast du gestern etwas gegessen?“ fragte der Herr.
„Ja ... gestern ..., als der Gendarm mich abführen sollte, gab mir die Ortsrichterin ein wenig Boršč* und ein Stück Brot.“
„Ja, so! Jetzt verstehen wir’s schon“, lächelte der Herr.
Er gab ihm zu frühstücken, ein tüchtiges Stück Brot und eine gestrige Kotelette. Der Ärmste griff danach mit zitternden Händen. Er wollte danken, brachte aber kein Wort hervor, nur Tränen liefen ihm die Wangen hinab.
Und seht ihr, noch ein unverhoffter Charakterzug an diesem Burschen. Seine Gestalt war so durchaus jüdisch, daß sie fast abstieß, aber in seinem Charakter gab es, wie es schien, gar nichts Jüdisches. Still, gehorsam, ohne eine Spur gewöhnlicher jüdischer Selbstüberhebung, nicht plauderhaft; wenn man ihm aber etwas zu schaffen befahl, so war er rasch wie ein Blitz. Es war so etwas Natürliches, Bauernhaftes in seinem ganzen Gebahren. Wenn es nichts zu schaffen gab — und was kann [es] da bei uns in der Zelle viel zu schaffen geben! —, so liebte er es, in der Ecke still zu sitzen, zusammengekauert, mit den Händen seine Knie umspannend und den Kopf auf die Knie stützend, so daß nur seine Augen aus der dunklen Ecke hervorglänzten wie die Augen einer neugierigen Maus.
„Na, so sag uns doch, was für einen schrecklichen Raub du begangen hast, daß der Gendarm dir dafür mit dem Galgen gedroht hat?“ fragte ihn Herr Žurkovśkyj als wir schon merkten, daß der Bursche ein wenig ruhiger und zahmer geworden war.
„Ach, Herr“, seufzte Josel und ein Zittern ging über seinen ganzen Körper, „viel wäre da zu erzählen und wenig zu hören. Es ist eine sehr dumme Geschichte.“ „Nur zu, nur zu! Erzähle, wir hören zu. Wir haben ja auch so hier nichts Vernünftiges zu tun, so können wir auch eine dumme Geschichte hören.“
„Ich wuchs auf im Hause des Moško — so heißt der Schankwirt in Smerekiv“, so begann Josel seine Erzählung. „Anfangs spielte ich zusammen mit seinen Kindern, nannte den Moško ,Tate‘ und seine Frau ,Mamo‘. Ich dachte, sie seien meine Eltern. Bald aber merkte ich, daß Moško seinen Kindern schöne Bekeschen anfertigen ließ und seine Frau ihnen jeden Freitag weiße Hemdchen gab, während ich schmutzig und verlumpt herumlief. Als ich sieben Jahre alt wurde, schickte man mich aus, Gänse zu hüten, damit sie keinen Schaden anrichten. Moškos Frau fragte nicht, ob es draußen kalt, regnerisch oder heiß sei, sondern trieb mich vom Hause auf den Weideplatz und gab mir dabei immer weniger zu essen. Ich hungerte, weinte oft auf dem Weideplatze, aber alles dieses half nichts. Die Bauernkinder waren besser mir gegenüber. Sie gaben mir Brot, Käse, erlaubten mir, an ihren Spielen teilzunehmen. Ich gewöhnte mich an sie und später begann ich sie im Gänsehüten zu vertreten. Ich war für meine Jahre stark und behend, und so begannen die Bauernfrauen auch selbst mir ihre Gänse und später die Kälber anzuvertrauen, wenn ihre Kinder in die Schule gehen mußten. Dafür bekam ich von ihnen Brot, warmes Essen und manchmals an Feiertagen auch etliche Kreuzer. Moškos Frau war sehr geizig und es war ihr nur heb, daß ich zu Hause nicht zu essen bat. Allein Moško [ ...]*
____________________
* Boršč ist eine Art Suppe, welche aus dem saueren Saft der roten Rüben gekocht wird (Anm. Frankos)
* In den weiteren Teilen der Erzählung wird berichtet, wie Josel Stern sich gewaltsam seiner in Moškos Hause auf bewahrten Papiere bemächtigt, dafür halbtot geprügelt und schließlich ins Gefängnis gesperrt wird. Diesen Aufenthalt nutzt er fieberhaft, alles das nachzuholen, was er in mehr als zehn Jahren versäumt hatte. Beim Lesen eines Buches in unmittelbarer Nähe des Zellenfensters wird Josel jedoch von einem Wachposten erschossen. Die gerichtliche Verfügung seiner Freilassung kommt zu spät
======================
Die Niederschrift dieser Erzählung in ukr. Sprache erfolgte in Lemberg im September 1889. Dem vorliegenden deutschen Text, entstanden vermutlich im drauffolgenden Jahre, liegt ein zehnseitiges fragmentarisches eigenhändiges Ms. Frankos der Übersetzung dieser Erzählung (Sign.: F. 3, 342) zugrunde (die erste u. zweite Seite sind unten beschädigt).
Der ukr. Text der Erzählung wurde 1908 [err.: 1890 - Z] in Nr. 2—3 der „Зоря“ veröffentlicht. Im gleichen Jahre erschien sie erneut in der Sammlung „В поті чола“, Lemberg, S. 267—88. Der Kiewer Verlag „Вік“ druckte „До світла!“ im 2. Bd. der gesammelten Werke des Dichters („Збірник творів“, Kiew 1903) nach. Der in Твори, Bd. 2, Kiew 1950, S. 338—55, gebotene Text folgt der Fassung in der Sammlung „В поті чола“.
Das zum gleichen Thema im September 1889 von Franko verfaßte Ge dicht „Був вечір, ми в казні вже спати лягли ..vgl. in Твори, Bd. 13, Kiew 1954, S. 412ff.
Eine vollständige Übersetzung dieser Erzählung aus dem Russischen ins Deutsche findet sich in dem Band „Iwan Franko. Miron und der Riese“, Berlin 1954.
30.09.1963