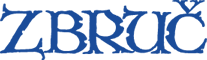Ich ertrag’ es nicht! Kann es nicht mehr ertragen!
Ich muß beichten. Muß ein öffentliches Bekenntnis meiner Sünde ablegen, ob ich auch im voraus weiß, daß meine Seele dadurch nicht erleichtert werden wird. Ach, eine Sühne ist ja nicht möglich, denn welche Sühne wäre imstande, unschuldig vergossenes Blut gutzumachen, ein hingemordetes Leben zu ersetzen? Ja, ich trage einen Mord, einen schändlichen, zwecklosen Mord auf dem Gewissen. Das heißt, nicht diesen einen allein. Der Mensch ist ja ein großer, systematischer, raffinierter Mörder unter den Geschöpfen Gottes, welche ihrerseits auch das ihrige zu der allgemeinen großen Mordsymphonie redlich beisteuern, die man „das organische Leben“ zu nennen behebt. Wir morden alle auf Schritt und Tritt, wir schlachten, zertreten, zerquetschen, rotten Millionen lebendiger Geschöpfe aus. Können keinen Augenblick ohne Mord leben. Und das Interessanteste dabei ist — wir merken es selbst nicht. Aber nicht nur die verdammten Mikroorganismen gehen uns wenig an. Auch unsere höheren Brüder, die Schuppen-, Schal- und Säugetiere, morden wir ohne Gewissensbisse hin und beruhigen uns mit dieser einzigen und höchsten raison d’état: Wir brauchen sie, um selbst zu leben.
Als Mensch, als Insektensammler, als passionierter Fischer trage ich gewiß viele Tausende solcher Morde auf meinem Gewissen. Und doch sind sie alle vergessen und nur dieser eine quält und nagt und bohrt mir in der Seele seit vielen, vielen Jahren. Nur dieser eine stirbt und erlischt nicht und lebt immer wieder, immer schmerzlicher in meinem Inneren auf, je mehr ich mich bemühe, ihn zu vergessen und zu verwischen.
In unheimlicher Klarheit, mit allen Einzelheiten steht noch die ganze unselige Begebenheit vor meiner Erinnerung.
Viele Jahre, gewiß mehr als drei Dezennien, sind schon verflossen, als dies geschah. Ich war damals ein junger Bauernbursche und lief spielend in Wäldern und Feldern meines Heimatdorfes herum.
Es war eben Frühling gekommen, einer der ersten schönen warmen Tage. Es war das erstemal, daß wir nach langer Wintergefangenschaft uns frei herumtummeln konnten. Wir liefen auf die Wiese, die noch kahl und grau war von der kaum abgeworfenen Winterdecke. Nur hie und da sproß frisches zartes Grün aus der Erde empor: vorwitzige Rohrstengel, Kren- und Lattichblätter an dem Bache. Nur in dem nahen Walde war es ganz weiß von Schneeglöckchen, deren Blütezeit schon zu Ende ging, von weißen und blauen Anemonen.
Der Himmel wölbte sich tiefblau über uns, die Sonne lächelte, und auf den fernen Gipfeln der Karpaten glänzten noch mächtige Schneemützen wie funkelnde Diamantenkronen. Ihre Schönheit rührte uns wenig, denn jeden Augenblick spürten wir den kalten Winterhauch, der von ihnen herabging, ostwärts in die Täler. Auch der Bach spürte es: Am Morgen klar und rein und sommerlich ruhig plätschernd, gurgelte er jetztH seinen engen Ufern gar mißmutig und zwängte sein gelblich-schmutziges, angeschwollenes Gewässer zu Tal; es waren eben jene glitzernden Diamanten da oben vor der Frühlingssonne geschmolzen.
Doch wir ließen uns in unserem Frühlingstaumel nicht stören. Wir gingen und köpften und sprangen und liefen herum und besuchten alle unsere Bekannten: die alte mächtige Eiche am Waldesrande, in deren starkem Geäst wir im Sommer mit den Eichkätzchen um die Wette herumgeklettert waren, die schräg gewachsene Birke mit trauervoll herabhängenden schlanken Zweigen, die wir zu einer Schaukel zu mißbrauchen pflegten, die stillen Quellen im Wälderdickicht, wo wir hinter mächtigen Ahornstämmen hingekauert das Treiben der Füchse, der Dachse und der Wildschweine zu beobachten pflegten, und endlich die tiefen und klaren Wassertümpel, wo wir jeden Sonntag mit Angelhaken auf Hechte lauerten und uns im kalten, klaren Wasser erfrischten.
Die Umgebung dieser Wassertümpel, unseren beliebtesten Spielort, untersuchten wir ganz genau. Es war der Abflußort eines alten, mächtigen Teiches. Durch das enge Tal zog sich quer ein großer Damm, der jetzt das Aussehen eines langen, geraden Hügels hatte und nur an drei Stellen durchbrochen war: von dem sich in vielen Windungen hindurchzwängenden Bache und von den beiden Wassertümpeln, den einzigen Überbleibseln alter Teichherrlichkeit. Sie waren nicht breit, klaftertief, hie und da mit Erlenbäumen und Weidengebüsch umrahmt und im Sommer bis an den Wasserspiegel mit fettem Wiesengras und Blumen umwachsen. Jetzt freilich sah die Umgebung ziemlich kahl und traurig aus, und auch im Wasser, wo es im Sommer vom Geplätscher der Hechte und vom Herumspazieren der scharenweise einherziehenden Rotaugen ziemlich lebhaft zuging, war es still. Trotzdem guckten wir auf Schritt und Tritt neugierig hinab, ob uns nicht der eine oder andere Hecht unter der Eisdecke erstickte oder ob uns die Fischotter nicht einen Besuch abzustatten beliebt hatte.
,,Sß! Sß!“, zischten auf einmal zwei oder drei Knaben, die vor mir gingen, duckten sich und begannen vorsichtig um einen dichten Strauch zu schleichen, um ihn von allen Seiten zu umstellen.
„Was habt ihr denn? Was ist los?“, fragte ich, unwillkürlich flüsternd.
„Ein Vogel! Ein Vogel! Siehst du nicht?“
„Wo ist er denn?“
„Hier im Strauch. Er lief. Er fliegt nicht.“
Während die Knaben den Strauch umstellten, ging ich zum Strauch, bog vorsichtig die Zweige auseinander und erblickte wirklich einen kleinen Vogel im vorjährigen, trockenen Grase versteckt. Ich weiß nicht, ob er schwach oder erschrocken war; genug, er ließ sich ganz ruhig ergreifen. Alle Knaben liefen herbei, um den Gefangenen zu betrachten.
„Ach, wie schön!“
„So einen Vogel sah ich noch nie!“
„Seht nur seine Augen!“
„Und sein Gefieder!“
Es war ein kleiner Sumpfvogel, dergleichen wir in unserer Gegend sehr selten zu Gesicht bekommen. Er hatte aschgraues Gefieder mit einem feinen Perlenglanz, einen grünlichen, dünnen Schnabel und ebensolche Stelzfüße. Er saß ruhig in meiner Hand, sträubte sich nicht, kratzte und pickte nicht, wie es andere wilde Vögel tun, wenn sie gefangen werden.
„Was wirst du mit ihm tun?“, fragten mich verschiedene Knaben, mit neidischen Blicken die schöne Beute in meiner Hand betrachtend.
„Werd’ ihn nach Hause tragen.“
„Wirst ihn vielleicht braten?“
„Was weiß ich. Werd’ ihn füttern.“
„Und weißt du, was er frißt?“
„Werde schon sehen. Frißt er nicht Brot, so frißt er Fliegen. Frißt er nicht Fliegen, so frißt er Würmer oder Samen oder Schnecken. Werde schon etwas finden für ihn.“
Ich trug den kleinen, schönen Vogel wirklich nach Hause und setzte ihn nicht in einen Käfig, sondern in die Doppelfenster, wo er mehr Platz zum Laufen und Flattern, mehr Licht und frische Luft haben konnte. Der Vogel flog und flatterte nicht, sondern lief nur die Fensterscheiben entlang, hie und da mit seinem zarten Schnäbelchen das Glas anpickend, immer aber, wie mir schien, mit einer tiefen Sehnsucht in die weite freie Welt hinausblickend. Manchmal hielt er still, nickte mit dem Köpfchen oder verdrehte es so, daß das eine Auge in dem Geäst des nahen Apfelbaumes umherzuirren schien, und nickte dann wieder mit dem Kopfe so traurig und resigniert, als wollte er sagen:
„Ja, es ist schön und warm dort draußen, aber mit meinem Frühling ist’s aus!
Ich bin gefangen!“
Es gab mir förmlich einen Stich ins Herz, wie ich diesen Vogel einige Augenblicke so betrachtet hatte. Es wurde mir so traurig zumute.
„Laß ihn los! Wozu willst du ihn hier halten?“, schien etwas in meinem Inneren zu flüstern.
„Er ist aber so schön! Und ich hab’ ihn ja gefangen!“ sagte ich trotzig zu mir selbst. „Er wird sich vielleicht zähmen lassen. Wenn ich nur wüßte, womit ich ihn füttern muß!“
Mit dem Füttern hatte ich wirklich meine liebe Not. Ich legte dem Vogel kleine Brotkrumen, Hanf- und Hirsenkörner, getötete Fliegen und endlich einige Würmer, jede Sorte Nahrung besonders in kleinen Muschelschalen, zurecht, gab ihm auch ein Töpfchen voll Wasser und ging weg, um ihn in Ruhe zu lassen. Wie ich abends wieder nach Hause kam und zu meinem Vogel hinsah, hatte er von der Nahrung nichts angerührt, sondern saß in einer Ecke, streckte den dünnen Hals hoch empor und blickte unverwandt durchs Fenster hinaus der untergehenden Sonne entgegen und nickte manchmal mit dem Köpfchen so traurig, so traurig und resigniert, daß ich es nicht länger anschauen konnte und davonlief.
Vielleicht ist es ein Nachtvogel, dachte ich mir, und wird erst nachts fressen.
Dieser Gedanke beruhigte mich ein wenig und ich schlief ruhig und dachte nicht weiter an den Vogel. Am anderen Morgen lief ich noch vor Sonnenaufgang zum Fenster. Der Vogel saß noch immer an derselben Stelle, wo ich ihn gestern abends gesehen hatte, hielt noch immer den Hals emporgestreckt und blickte noch immer unverwandt durchs Fenster in die weite, freie Welt da draußen und nickte noch immer ab und zu mit dem Kopfe als wollte er sagen:
„Ja, es ist schön da draußen, aber mit meinem Frühling ist’s aus! Ich bin gefangen und komme hier nicht lebendig heraus.“
Von der Nahrung hatte er nichts angerührt.
„Laß ihn los! Laß ihn los!“ schrie etwas in mir. „Wozu willst du ihn quälen?
Er wird ja verhungern.“
„Nein“, rief eine andere trotzige Stimme in mir, „ich werde doch herausfinden, was er frißt. Ich will ihm Schnecken und Froschlaich bringen.“
Ich weiß nicht, woher ich darauf gekommen bin, daß er Froschlaich fressen könne. Genug, ich lief hin, sammelte allerlei kleine Schnecken, Insekten, fischte auch eine tüchtige Portion Froschlaich aus dem Wasser heraus und brachte das alles meinem Gefangenen. Er ließ alles ruhig vor sich hinlegen und zeigte nicht die geringste Neugierde, nicht eine Spur von Appetit nach allen diesen Leckerbissen. Nur die Sonne und die Wolken und die Wärme und der Frühling da draußen schienen ihn ausschließlich zu interessieren.
Ich hatte an diesem Tage irgendeine Beschäftigung, ging also weg und kam erst abends dazu, nach meinem Vogel zu schauen. Er ging leise nickend an den Fensterscheiben vorbei und hatte noch nichts von der Nahrung angerührt,
Es ist doch merkwürdig, dachte ich und wollte ihm gleich die Freiheit wiedergeben. Doch es kam mir der Gedanke, er werde wohl schwach und zum Fliegen unfähig sein, und wenn ich ihn jetzt am Abend in dem Hof frei herumlaufen lasse, wird er für unsere Katze eine sichere Beute sein. Es wird besser sein, wenn er noch heute bei mir übernachtet. Morgen in aller Früh trage ich ihn dort hinaus, wo ich ihn gefangen habe, und lasse ihn frei.
Während ich mir diesen Plan zurechtlegte, nickte der Vogel traurig mit dem Köpfchen und blickte mit einem Auge zum Wipfel des Apfelbaumes empor, als wollte er seufzen:
„Ach, mit meinem Frühling ist’s aus! Ich bin gefangen! Ich bin auf ewig verloren!“
Am anderen Morgen, kaum aus dem Bette, lief ich zu meinem Gefangenen hin. Er hatte noch immer keine Nahrung genommen und saß matt und ermüdet in seiner Ecke, mit den Augen immer durchs Fenster ins Freie blickend. Er ließ sich ruhig ergreifen und blickte mich mit denselben unsäglich traurigen Äuglein an, wie er die Sonne durch die Fensterscheiben angeblickt hatte. Er nickte sogar einmal mit dem Kopfe als wollte er sagen:
„Ja, ja, ich weiß schon, wohin ich getragen werde. Ich wußte schon längst, daß es so kommen werde.“
Ich trug ihn hinaus in den Hof. Er saß ruhig in meiner flachen Hand und sträubte sich nicht. Ich fühlte sein weiches Gefieder und seinen warmen Körper.
Sein Fleisch muß aber schmackhaft sein, schoß mir auf einmal der Gedanke durch den Kopf. Wie, wenn du ihn schlachtetest und braten ließest?
„Laß ihn los! Laß ihn los!“ flüsterte etwas wie ein guter Engel in meinem Innern. „Du siehst ja, er ist so klein. Es ist gar nicht der Mühe wert, ihn zu braten.“
„Aber es ist doch schade, ihn loszulassen. Ich hab’ ihn gefangen!“ bäumte sich der kindliche Trotz in meinem Inneren auf.
„Laß ihn los! Laß ihn loß!“ erinnerte es leise, leise in der tiefsten Tiefe meiner Seele.
Der Vogel aber saß ruhig und resigniert da. Ich öffnete die Hand — er floh nicht. Etwas Abscheuliches, Höhnisches triumphierte in meinem Busen.
„Siehst du! Er will nicht! Du hast ihm die Möglichkeit gegeben zu fliehen, warum flog er nicht fort?“
„Er ist ja schwach und hungrig!“ wimmerte es leise, leise tief in meiner Seele. „Ach was!“ schrie der kindliche Eigensinn, und im nächsten Augenblicke hatte ich dem kleinen schönen Vogel den Kopf abgedreht. Einmal oder zweimal zappelte er leise mit seinen Füßchen, aus seinem Halse flossen zwei oder drei Tropfen Blut, und aus war’s mit dem kleinen, schönen Vogel. Eine kalte, leblose Leiche lag in meiner Hand.
Und nun auf einmal war mein ganzer Trotz, mein Eigensinn, mein Egoismus gebrochen, wie weggefegt. Ich fühlte es dunkel, daß ich eine dumme, abscheuliche Tat getan, daß ich einen herzlosen Mord begangen, eine nicht zu tilgende Schuld auf mich geladen habe. Ich habe ja ganz zwecklos ein schönes, unschuldiges Leben zerstört! Hier, in Gottes freier Luft, im Angesicht der schönen, warmen Frühlingssonne habe ich ein grausames, durch nichts motiviertes Todesurteil gefällt und auch vollzogen. Ich fühlte es jetzt ganz klar und deutlich, daß dieser Mord ganz zwecklos war. Ich werde ja diese arme Leiche weder rupfen noch essen können. Ja, sie noch einmal anzuschauen, ging über meine Kraft. Ich ließ den toten Vogel aus meiner Hand fallen, und verschämt, zerknirscht, niedergeschlagen und verwirrt lief ich weg, weit weg, um ihn nicht mehr zu sehen, um sogar die Erinnerung an ihn aus der Seele los zu werden. Ich hätte gern geweint, aber ich konnte nicht; die Beklemmung in meiner Seele war zu groß, als daß sie sich in Tränen hätte auslösen können. Ich trug den kleinen, schönen Vogel in meiner Seele mit, und es schien mir immer, daß er mich mit seinen unsäglich traurigen Augen still resigniert anblicke, mit dem Köpfchen nicke und leise, leise flüstere:
„Ja, ich wußte es, daß es aus sei mit meinem Frühling, daß diese Gefangenschaft auch mein Tod sein werde!“
In dem weichen, leichtfertigen Kinderherzen dauerte die Beklemmung nicht lange. Nach zwei, drei Tagen hatte ich den Vogel und sein Mißgeschick vergessen — wie es schien für immer. Die Erinnerung an mein Verbrechen hatte sich in einem dunkeln Winkel meiner Seele hingelagert und wurde allmählich von anderen Eindrücken und Erinnerungen überschüttet, bedeckt und begraben.
Und doch war sie nicht tot. Es vergingen volle zwölf Jahre, und als mich das erste große Mißgeschick meines Lebens traf, als ich jung, lebensgierig und liebelechzend mitten in einem prachtvollen Sommer im Gefängnis schmachtete und fühlen mußte, daß alle meine Hoffnungen zerronnen, alles das, was ich als mein Lebensglück betrachtet hatte, erbarmungslos zerschlagen, niedergetreten, zweckend sinnlos vernichtet und verwüstet wurde, da, in einer angstvollen, schlaflosen Nacht erschien mir der kleine, schöne Vogel, stachen mich mitten ins Herz seine traurigen, still resignierten Blicke, flüsterte wieder sein Nicken die unheimlich schrecklichen Worte :
„Ja, mit meinem Frühling ist’s aus! Ich bin gefangen! Ich weiß schon, wie das enden wird.“
Und seitdem kann ich diese Erinnerung nicht los werden. Sie vergiftet mir jeden glücklichen Augenblick sie raubt mir Kraft und Mut im Unglücke. Sie quält mich mit Gewissensbissen, und es scheint mir, als ob alles Dumme, Zwecklose, Grausame und Schlechte, was ich in meinem Leben begangen habe, in diesem kleinen, schuldlos hingemordeten Vogel ein konkretes Bild erhalten habe, um mich desto wirksamer zu quälen. In stillen Nächten höre ich diesen Vogel leise, leise an die Fensterscheiben picken und fahre aus dem Schlummer auf, und in Momenten der Angst und der Verzweiflung, wo ein wilder Schmerz meine Seele umkrallt und meine Willenskraft zu brechen droht, fühl’ ich mich selbst eins mit diesem schwachen, hungrigen Vogel, fühle, wie mich ein eigensinniges, trotziges und unverständiges Geschick in seiner Hand hält, wie es mir trügerische Phantome von Freiheit und Glück vorgaukelt, um mir vielleicht im nächsten Augenblicke grundlos und zwecklos den Kopf abzudrehen.
===========================
Diese Erzählung wurde erstmals im „Літературно-науковий вісник“ (1898, Bd. 1, H. 3) veröffentlicht und erschien im gleichen Jahr in deutscher Sprache in der von Rudolf Lothar herausgegebenen Wiener Wochenschrift „Die Wage“ (Nr. 34/1898, S. 568—70). Sie wurde 1903 in den in Kiew verlegten Almanach „Дубове листя“ aufgenommen und 1905 in der in Lemberg erschienenen Sammlung „На лоні природи й інші оповідання“, der auch der in Твори, Bd. 3, Kiew 1950, S. 249—55, veröffentlichte Text zugrunde liegt, nachgedruckt.
Vgl. hierzu auch die im Anhang wiedergegebenen Briefe Rudolf Lothars aus dem Jahre 1898, welche auf Zusendung und Honorierung der Erzählung Bezug nehmen.
30.09.1898