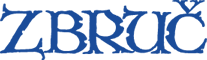[Fragment]
„Ja, Herr“, sagte zu mir der alte Pfarrer eines weltentlegenen Gebirgsdorfes, bei dem ich im vorigen Sommer zu Gast war, „unsere Huzulen sind ein besonderes Volk. So eine Mischrasse und dabei doch ganz eigenartig, sozusagen von der Bronzekultur unmittelbar in das allermodernste Proletariat hinüberspringend. Den modernen Institutionen hilf- und ratlos gegenüberstehend, für Staats-, Landesund alle übrige Ordnung ohne jegliches Verständnis und doch in dem Bereiche ihrer Fassungs- und Anschauungskraft hochbegabt, energisch, unternehmend und arbeitslustig. Und auch ihre Gewohnheiten, ethische und religiöse Anschauungen, das, was man die Seele eines Volkes nennt — ich sage Ihnen, Herr, es ist ein Studium, ein umfang- und rätselreiches Buch. Ich studiere darin schon dreißig Jahre, und doch kommt mir manchmal so ein Fall, so eine Mischung von Barbarei und Edelmut, von geistiger Regheit und regem Verstände vor, daß ich einfach erstaune und mit meiner ganzen theoretischen und praktischen Bildung der Geschichte nicht beikommen kann.
Ich will Ihnen einen solchen Fall erzählen.
Es war im vorigen Jahr, grade zur Zeit der heißesten Heumahd, als ich zu einem kranken Huzulen abberufen wurde. Ich kannte den alten Mykola Kuceranjuk sehr gut, und wer kannte ihn nicht im ganzen Dorfe, ja, im ganzen Ceremos-Gebiet*! War er doch der beste Kermanyč* am ganzen Čeremoš und überdies ein durch und durch ehrlicher und gutmütiger Mann, ein tüchtiger Arbeiter, wohlhabender Grundwirt, nüchtern, pünktlich und ordnungsliebend. Noch vor einer Woche war er mit einem Floß nach Krty gegangen und schien ganz gesund und guter Dinge zu sein. Darum wollte ich anfangs der Nachricht von seiner schweren Erkrankung gar nicht glauben. Der Doktor, welchen die Söhne des Alten — zwei davon waren bereits verheiratet und der dritte noch ledig — aus Zabie geholt hatten und welcher auf der Rückkehr bei mir übernachtete, war bei den Fragen über Mykolas Krankheit noch mürrischer und einsilbiger als gewöhnlich und brummte nur in den Bart: „Gewöhnliches Flößerübel — Lungenentzündung.“ Dann, nach einer Weile, fügte er mit einer lässigen Handbewegung hinzu: „Der Alte ist noch stark wie eine Eiche, wird die Geschichte schon überstehen, wenn nur...“ Und er brach mißmutig ab und sprach über etwas anderes. Alles in allem schien mir die Sache gar nicht so ernst, und darum war ich höchlich überrascht, als mir an einem Nachmittage der jüngste Sohn Mykolas zu Pferde, noch zwei ledige, gesattelte Pferde am Halfter führend, in den Hof hereingezogen kam und mich bat, sogleich zu seinem Vater zu raiten und demselben das letzte Viatikum zu geben.
„Ist denn der Vater wirklich so krank?“ fragte ich verwundert. „Worüber klagt er denn?“
„Über nichts Besonderes“, antwortete ruhig Dmytro, ein stämmiger, bildhübscher Bursche. „Er sagt nur, er müsse sterben und wolle vordem seine Seele erleichtern.“
Der Gleichmut, mit welchem unsere Bauern und ihre Angehörigen den Tod hinnehmen, war für mich nichts Neues. Ich ließ Dmytro den Kirchensänger holen, richtete alles Nötige in der Kirche zurecht, nahm noch etwas Proviant mit, da ich wußte, daß ich im Gebirg werde übernachten müssen, bestieg das huzulische „Pferdchen“, und wir machten uns auf den Weg.
Huzulische Dörfer liegen weit verstreut. Kein Dorf nimmt nicht weniger als zehn Quadratmeilen Flächenraum ein und beträgt doch nicht mehr als 500 Hausnummern. Die Huzulen wohnen nicht gerne nahe beieinander. Im Gegenteil, sie bauen ihre Hütten am liebsten auf hohen Bergabhängen, inmitten der Wälder, so weit voneinander, daß zum nächsten Nachbar oft eine oder zwei Stunden Weges notig sind. Solche entlegene Gehöfte hegen manchmal zwei oder drei Meilen vom Hauptdorfe entfernt, und so gibt es eine Menge Pfarrkinder, die ich nur zweimal in meinem Leben zu sehen bekomme: bei der Taufe und beim Begräbnisse. Sogar unter den Erwachsenen gibt es nicht wenige, welche nur ein-oder zweimal im Jahre Lust und Muße bekommen, ins Dorf hinabzuwandern und die ganze übrige Zeit in ihrer luftigen Höhe, fern von Menschen, unter unaufhörlichem Windgebraus, beim Rauschen der Wälder, dem Tosen der Gebirgsbäche, unter dem Vieh und wildem Getier verbringen. Welche Lebensansichten, Gewohnheiten und Begriffe sich unter solchen Umständen bilden und von Jahrhundert zu Jahrhundert überliefert werden, könnt ihr euch schon vorstellen.
Langsam, im Gänsemarsch, ritten wir auf engen, halsbrecherischen und für kein anderes Zugtier außer dem wunderklugen huzulischen Zwergpferde passierbaren Gebirgsstegen vorwärts, an rauschenden Gebirgsbächen vorbei, die steilen Rutschwände in wilden Zickzacklinien empor, durch dunkle, unwegsame Wälder, über bodenlosen Abgründen, wo die riesigen Tannen ganz unten für uns nicht größer als Weihnachtsbäumchen erschienen. Endlich waren wir auf der Alpe, welche mit prächtigen Gräsern und duftigen Blumen bedeckt war und ritten nun auf einem engen Gebirgskamme immer höher und höher hinan, bis wir kurz vor Sonnenuntergang das Ziel unserer Reise, die hohe Alm Katrafijoryj, erreichten. Hier, in einem engen, löffelförmigen Tale, von Norden geschützt durch die steile grüne Wand der obersten Bergesspitze, mit einer wunderbaren Aussicht nach Westen und Süden, lag das einsame Gehöft des alten Kučeranjuk, von weitem einer im Quadrat gebauten, tür- und fensterlosen, unzugänglichen und niedrigen Holzbefestigung gleichend. Eine Ecke dieser Befestigung bildete das Wohnhaus; die in der Diagonale des Quadrats entgegengesetzt liegende Ecke war der Stall ; die übrigen Ecken wurden von hohen Bretterwänden gebildet; in der südlichen Wand konnte man erst in nächster Nähe das Eingangstor sehen, welches immer von innen verschlossen war — eine natürliche Wohnungseinrichtung in der Gegend, welche jahrhundertelang das Hauptnest und der Tummelplatz des karpatischen Räuberwesens bildete, welches hier noch in der Mitte des 19. Jahrhunderts nicht gänzlich ausgerottet war.
Wie wir an das Eingangstor gelangten, klopfte Dmytro mit der Faust an und ließ zugleich seine Stimme erschallen. Das Tor wurde geöffnet und wir ritten in den kleinen Hof ein, welcher in der Mitte mit einem grünen Rasenflecke bedeckt war. Die beiden älteren Söhne Mykolas kamen mir entgegen, küßten meine Hände und halfen mir vom Pferde herab, welches sie sogleich absattelten und mit den anderen in den Stall führten. Im Hofe lag auf dem grünen Rasen ein prachtvoller, buntfarbiger Kotzen ausgebreitet und darauf, mit einem Kissen unter dem Kopfe und mit einem weißen Leintuch leicht zugedeckt, lag der Kranke. Nicht weit von ihm, auf rohen Holzklötzen, saßen einige Huzulen, die reichsten Nachbarn Mykolas, durchwegs ältere Männer, welche bei der Kunde von seiner schweren Krankheit hierhergekommen waren, um die Nacht bei dem Kranken zuzubringen und eventuell Zeugen seines Todes zu sein. Sie alle erhoben sich bei meiner Ankunft von ihren Sitzen, nahmen ihre Hüte ab und kamen nach der Reihe heran, um meine beiden Hände zu küssen. Den Schluß bildeten die beiden jungen Schwiegertöchter des Kranken, welche sich in der Hütte beim Feuerherd zu schaffen machten und — ich wußte es gut — bereits mit der Vorbereitung des Todesmahls beschäftigt waren. Endlich kam ich dazu, mich dem Kranken zu nähern.
Er war bei meiner Ankunft ruhig, gleichsam schlafend gelegen, das Antlitz grade nach oben gerichtet, mit den Augen in den dunkelblauen Himmel unverwandt starrend.
„Wie geht es dir, Mykola?“ sagte ich, nahe an sein Lager herantretend. „Was machst du da für Späße mit dem Kranksein?“
Er wandte sein müdes, aber gar nicht verändertes, nur etwas abgehärmtes und abgeblaßtes Antlitz mir zu und lächelte schwach.
„Ich sterbe, Panotez. Mit dem Sterben ist kein Spaß.“
„Aber es ist ja gar nicht so schlimm mit dir!“ versuchte ich ihn aufzurichten.
„Wo schmerzt es dich denn? Hast du alles befolgt, was dir der Doktor gesagt hat?“ „Wir haben alles getan, hochwürdiger Panotez“, sagte der ältere Sohn, „und die Schmerzen sind nicht mehr so heftig, wie sie anfangs waren. Der Vater klagt nicht mehr über das Seitenstechen. Auch das Fieber hat sich ein wenig gelegt.“ „Dummes Zeug das alles“, sagte der Alte halb verächtlich und halb resigniert.
„Man stirbt nicht am Seitenstechen oder am Husten oder am Fieber, sondern an dem Tod. Wenn der Tod da ist, so ist kein Rekurs dagegen und kein Kraut und kein Geruch kann da was helfen. Und mein Tod ist da, ich weiß es ganz genau.“
Darum habe ich auch den Kindern gesagt: ,Schickt nicht nach dem Doktor! Wozu brauche ich den Doktor? Er wird mir ja nicht helfen und euere Börsen wird er um etliche Gulden leichter machen.'“
Er sprach das mit einer zwar leisen Stimme, langsam, etwas zischend, aber doch ganz ordentlich und klar, mit der Gesetztheit, wie sie den alten, durch schwere Lebenspraktik in sich gefestigten Bauern eigentümlich ist. Doch wurde er nach dieser Rede von einem trockenen, wie es schien, recht qualvollen Husten befallen, welches ich nie bisher bei ihm gemerkt hatte.
Ich bat ihn, sichH beruhigen und seine Gedanken zu sammeln, ließ die anderen alle sich entfernen und hörte seine Beichte. Er hatte nichts besonderes zu bekennen außer gewöhnlichen bäuerischen Alltagssünden. Ich betete für ihn, dann gab ich ihm im Beisein aller die heilige Kommunion und die letzte Ölung und es schien mir, daß er sich sehr beruhigt fühlte. Die Söhne fragten ihn, ob sie ihn vielleicht in die Hütte tragen sollten. Er wollte nicht und wies schweigend mit einer Kopfbewegung nach Westen. Eben ging die Sonne unter und begoß die Wolken in der Himmelsmitte mit funkelndem Purpure. Der Abglanz dieses Purpurs fiel auch [auf] die Dächer des Gehöftes und auf das Antlitz des Kranken, welcher dadurch den Anschein eines ganz gesunden Menschen bekam.
Ich setzte mich nun, nachdem ich die Meßgewänder abgelegt hatte, zu den übrigen Huzulen auf einen Holzpflock und wir begannen mit gedämpfter Stimme eine Unterredung über die laufenden wirtschaftlichen Angelegenheiten, über die Heumahd, die Holzflößerei, die Viehpreise und was noch sonst für einen Gebirgsbewohner interessant ist. Plötzlich warf ein alter Huzule, der älteste im ganzen Kreise, sich zu mir wendend die Frage auf: „Verzeiht, Panotez, warum habt ihr den Mykola nicht gefragt, woher er denn weiß, daß er heute sterben muß?“ „Sprach er denn davon, er wisse es so genau?“ antwortete ich verwundert. „Freilich hat er das gesprochen, ehe ihr gekommen seid.Mid als wir ihn fragten, woher er es wisse, sagte er: ,Ich werde es dem Panotez sagen.'“
„Nein, er hat es mir nicht gesagt“, antwortete ich und schaute mich unwillkürlich nach Mykola um, welcher wieder in seiner alten Lage, wie ein Toter auf der Bahre mit über die Brust gefalteten Händen, bewegungslos dalag und mit weit offenen Augen in den Himmel starrte. Er schlief nicht, und mir schien in seinen Augen etwas Sonderbares, etwas wie Angst und Schrecken durchzublicken. Wie er so schweigend, mit fest zusammengekniffenen blutlosen Lippen dalag, hatte ich nicht den Mut, eine Frage an ihn zu richten und mich wieder an die Huzulen wendend, sagte ich halb streng und halb lehrhaft:
„Übrigens, meine Lieben, ich dachte, er glaubt selbst nicht daran und ihr sollt auch nicht daran glauben. Die Stunde unseres Todes kennt niemand außer Gott allein, und wer vorgibt, Zukünftiges zu wissen oder offenbaren zu können, begeht eine schwere Sünde.“
In diesem Augenblicke ... drehte Mykola sich auf seinem Lager herum und rief seinen jüngsten Sohn, welcher sich über ihn vorbeugte.
„Dmytro, ist der Panotez noch da?“
„Ja, Vater. Er wird bei uns übernachten.“
„Bitte ihn zu mir. Ich habe ihm noch etwas zu sagen.
Ich stand schon neben ihm und nahm seine nun ganz fieberheiße Hand.
„Was ist dir, Mykola? Fühlst du Schmerzen? Es wird gut sein, wenn sie dich in das Haus hereintragen.“
„Nein, Panotez!“ sagte er und machte eine abwehrende Bewegung mit der Hand. „Dort ist es dunkel und rauchig. Und ich habe mein ganzes Leben lang Licht und reine Luft geliebt. Laßt mich hier liegen. Es wird schon nicht lang dauern. Aber was anderes wollte ich euch sagen. Panotez, ehrwürdiger, ich habe nicht gut gebeichtet.“
„Hast du noch eine Sünde verschwiegen?“
„Ja.“
„Hattest du sie vergessen oder mit Bedacht verschwiegen bei der vorigen Beichte?“
„Ich hatte sie nie vergessen — o, ich vergesse sie ja keinen Augenblick meines Lebens. Ich habe sie auch nicht mit Bedacht verschwiegen. (Hier hustete er eine Weile und versuchte umsonst, sich auf seinem Lager aufzurichten.) Wißt, Panotez, ich habe diese Sünde schon dreimal gebeichtet, bin um ihretwegen dreimal barfuß nach Sučava gegangen, habe dreimal die Absolution für sie empfangen und drei heilige Messen gestiftet. Und doch konnte ich mich bis jetzt nicht frei von ihr fühlen. Und jetzt, vor der letzten Beichte, dachte ich mir, ich sündiger Mensch: Vielleicht hat mir Gott doch schon die Sünde vergeben. Vielleicht sündige ich gar, wenn ich diese Sünde noch einmal beichte. Und darum verschwieg ich sie.“ „Ja, Mykola, das hast du richtig gedacht“, sagte ich. „Eine Sünde nach empfangener Absolution und nach getaner Buße noch einmal zu beichten, sich von ihr nicht frei zu fühlen, daß heißt an Gottes Güte und Vergebung und an der erlösenden Kraft des Heiligen Testamentes zu zweifeln. Du brauchst die Sünde nicht noch einmal zu beichten.“
„Und doch, Panotez, fühle ich, wie sie mir die Seele drückt. Sie liegt mir wie ein Stein auf dem Herzen. Ich kann keine Ruhe finden und darum kann ich nicht sterben. Sehen Sie, Panotez, wie ich so unter inbrünstigem Gebete in den Himmel geschaut habe, während die heilige Sonne untertauchte, schien es mir, als werde dort die Tür vor mir verriegelt, als lagere sich ein schrecklicher, dunkler Drache vor den Himmelseingang, damit ich nicht hineingelangen kann. Nein, Panotez, es war nicht recht — ich fühle es, es war nicht recht, daß ich die Sünde verschwiegen habe!“
Dieser Fall brachte mich in Verlegenheit. Was sollte ich ihm sagen? Sollte ich ihn noch einmal beichten lassen und somit meine vorigen, allen zu Gehör gesprochenen Worte über die Unzulässigkeit einer solchen Beichte Lügen strafen? Oder sollte ich der Kirchenlehre zuliebe den Mann in seiner Seelenangst lassen?
Da auf einmal erhob sich der alte Huzule, welcher vordem Mykolas Todesgewißheit zur Sprache gebracht hatte und jetzt auch meine Unterredung mit dem Kranken aufmerksam hörte, und sprach:
„Hört mich, Panotez! Höre mich, Mykola. Es muß eine ungewöhnliche Sünde sein, welche dir trotz Beichte und Absolution keine Ruhe läßt. Für solche Sünden reicht die gewöhnliche Beichte und gewöhnliche Absolution nicht aus. Unsere Väter und Großväter haben uns für solche Fälle die öffentliche Beichte empfohlen. Läßt dir, sagten sie, das Gewissen keine Ruhe, dringt dir eine begangene Sünde, eine schuldlos aus der Welt vertriebene Menschenseele in deine Träume hinein, so versammle die Gemeinde, die Ältesten von der Gemeinde, und beichte vor ihnen, öffentlich, aufrichtig, alles, wie es gewesen ist, und empfange ihren Urteilsspruch —, erst dann wirst du der Sünde und der Qual los. So ist es, Panotez, so haben es unsere Vorfahren gemacht, und diese haben es sehr gut gewußt, was ein von vergossenem Blut gequältes Gewissen bedeutet. So soll auch Mykola tun.“ Diese Anschauung von der größeren Kraft einer öffentlichen als der geheimen Beichte war für mich wirklich etwas Neues. Von einer solchen Tradition bei unseren Huzulen hatte ich vorher nichts gewußt und von der öffentlichen Beichte höchstens in der Kirchengeschichte oder in jenem Kosakengesange gelesen, wo der Kosakenataman seine Kampfgenossen, welche in schwachen Kähnen auf dem sturmgepeitschten Schwarzen Meere umhertreiben und dem sicheren Tode entgegengehen, dringend ermahnt:
„Beichtet, meine Brüder, dem lieben Gott,
Dem Schwarzen Meer
Und mir, eurem Ataman!“
Ich dachte nach und fand schließlich heraus, daß die Sache, obwohl aus dem Gebrauche gekommen, im gegebenen Falle doch gegen keine Kirchenvorschrift verstößt und wandte mich an Mykola:
„Nun, Mykola, was sagts du dazu? Magst du deine Sünde vor uns allen hier bekennen?“
„Ja“, sagte Mykola. „Ich wollte es euch selbst vorschlagen. Vielleicht finde ich so Ruhe und sterbe erleichtert. So hört denn, wie sich die Sache zugetragen hat!“ Wir rückten mit unseren Holzklötzen ganz nahe an sein Lager, während Dmytro, hinter dem Alten kniend, seinen Kopf mit dem Kissen emporhielt, so daß der Alte in eine halb sitzende Lage kam, was ihm auch das Sprechen erleichterte.
„Es sind mehr als dreißig Jahre her. Ihr, Panotez, kamt erst ein Jahr später zu uns ins Dorf, habt mich mit meiner seligen Maryna getraut. Ich war damals noch Junggesell und schon ein guter Kermanyč. Es war ein schöner Sommertag, grad so wie heute; auf allen Wiesen hat man Heu gemäht. Ich fuhr mit einem schönen vierteiligen Floß den Čeremoš herunter, und der Duft des frischen Heus und der reifen Himbeeren droben auf steilen Ufern wehte bis zu mir herüber und machte mir das Herz weit. Bei dem Vordersteuer stand der alte taube Petro, ich hatte das Hintersteuer zur Hand. Um Mittag kamen wir in Jaseniv an und hakten uns bei der Dorfschenke fest. Das Wasser war stark und wir hatten das Floß nur nach Kuty zu führen, und so hatten wir keine Furcht, daß das Wasser vor unserer Ankunft abfallen werde.
Am Ufer gab es, wie gewöhnlich, eine Menge Dorfbuben. Sie badeten, warfen mit Steinen, spielten am Ufer und lärmten. Sobald wir das Floß festgemacht hatten, liefen sie haufenweis auf dasselbe, sprangen über die Klötze, hüpften vom Floß herab ins Wasser oder machten sich auf den Klötzen zu schaffen. Wir waren daran gewöhnt, gingen in die Schenke, tranken unseren Schnaps und kehrten alsbald zurück. Ohne uns an die Jungen zu kehren, machten wir die Maschine los und stießen ab. Wirklich sprangen die Jungen, als das Floß sich in Bewegung zu setzen begann, flink und mit Geschrei herab in das seichte Wasser oder auf die Ufersteine [. . .] *
_____________________
* Čeremoš — ein Nebenfluß des Pruth, der größte Fluß im Huzulengebiete (Kosover Bezirk in Ostgalizien) (Anm. Frankos)
* Kermanyč — wörtlich Steuermann; ein Lotse, welcher die Flöße durch reißenden und vielfach gefährlichen Fluß hinabführt (Anm. Frankos)
* Im weiteren Verlauf der Erzählung wird berichtet, wie ein Junge, der vor der Weiterfahrt unbemerkt auf das Floß gestiegen war, später—nur von Mykola wahrgenommen — sich ins Wasser gleiten ließ und ertrunken ist. Trotz vergeblicher Versuche, sein Gewissen von diesem Alpdruck zu befreien, taucht vor Mykola immer wieder das Bild jenes ertrunkenen Knaben auf und läßt ihn keine Buhe finden. Sein Freund, der alte Huzule Petro, löst ihm schließlich dieses Rätsel, indem er ihm von einem eigenen Erlebnis, der „Geschichte vom Dom im Fuße“, berichtet. Ein beim Laufen in den Fuß gerissener Dorn verhinderte es, daß der junge Petro seine sich zum Baden in den Čeremoš stürzenden Kameraden noch erreichte. So sah nur er die heranbrausende Woge, die seine Freunde unter sich begrub; der Dom hatte ihm das Leben gerettet. Und so hat auch die Vision vom ertrunkenen Knaben aus dem Trunkenbold und Händelsucher Mykola einen ordentlichen und gutherzigen Menschen gemacht. Diese Gewißheit läßt den alten Huzulen nun auch zur letzten Buhe finden
========================
Diese Erzählung, verfaßt 1902, wurde erstmals in deutscher Sprache im Abendblatt der Wiener Wochenschrift „Die Zeit“, Nr. 527—32 (16.—21. März 1904) u. d. T. „Der Dom im Fuße. Eine Erzählung aus dem Huzulenleben“, veröffentlicht. In ukr. Sprache erschien sie im „Літературно-науковий вісник“ (Bd. 35—1906, H. 9 u. Bd. 36, H. 10). Der in Твори, Bd. 4, Kiew 1950, S. 384—98, verwendete Text stellt einen Nachdruck dieser Fassung dar. Der vorliegende Text konnte nur nach der Fotokopie eines handschriftlichen Textes u. d. T. „Ein Dorn im Fuße“ (vermutlich aus dem Jahre 1904, Fragment) im Umfang von 14 Bl. (es fehlen die Seiten 10—18 u. 22—23!), welche sich unter der Sign. F. 3, Nr. 344 findet, gestaltet werden.
Zu einer späteren Bearbeitung des in dieser Erzählung verwendeten Sujets in versifizierter Form vgl. das mit der gleichen Überschrift versehene Poem Frankos in: Твори, Bd. 13, Kiew 1954, S. 329 ff.
Erhalten gebliebene Briefe der Feuilleton-Redaktion des Tageblatts „Die Zeit“ an Franko (vgl. dazu den Anhang) weisen jedoch aus, daß bereits vor dem 27. Januar 1903 ein Ms. von der Hand Frankos der obengenannten Erzählung in der Redaktion vorhanden war („Wir haben von Ihnen zwei Erzählungen liegen, ,Der Dom im Fuß' und ,Der Bodenatz'“). Auf eine uns bislang unbekannt gebliebene Anfrage Frankoa vom 29. Mai des gleichen Jahres wird dem Dichter am 5. Juni mitgeteilt, „daß wir [gemeint ist die Redaktion] mit dem Abdruck Ihrer Erzählung ,Der Dorn im Fuße* noch eine Weile warten müssen, da wir nicht so rasch nach dem Erscheinen Ihrer ersten Fortsetzungsarbeit eine zweite Arbeit von Ihnen veröffentlichen wollen, sondern damit auf eine günstigere Gelegenheit zu warten gedenken, die sich vermutlich im Herbste einstellen dürfte“. Eine Begründung, weshalb die Erzählung nicht — wie vorgesehen — im Herbst des Jahres 1903, sondern erst im März des darauffolgenden Jahres publiziert worden ist, erfolgte nach vorhandenen Unterlagen nicht.
Hieran müßte sich die Erzählung Frankos „Thomas mit dem Herzen und Thomas ohne Herz“ chronologisch anschließen, die erstmals in deutscher Sprache in der belletristischen Beilage der Wiener Wochenschrift „Die Zeit“, Nr. 626 (19. Juni 1904, „Sonntags-Zeit“) veröffentlicht wurde. Leider blieb uns dieser Beitrag unzugänglich. Über die Annahme des Werkes zur Veröffentlichung vgl. das im Anhang abgedruckte Schreiben der Feuilleton- Redaktion des Tageblatts „Die Zeit“ an Franko vom 27. April 1904. Weitere deutschsprachige Veröffentlichungen: New York Staats-Zeitung vom 9. August 1904 (vgl. Doro- Senko, Матеріали I, Er. 78,3). Unter der Überschrift „Хома з серцем і Хома без серца“ erschien das Werk noch im gleichen Jahre auch in ukr. Sprache im ,,Літературно-науковий вісник“ Bd. 27, Н. 8). Im Jahre 1906 fand die Erzählung Aufnahme in die Sammlung „Місія. Чума. Казки і сатири“ (Ukrainisch-russische Verlagsgesellschaft [Lemberg]), auf deren Fassung auch der in Твори, Bd. 4, Kiew 1950, S. 303—22, gebotene Text zurückgreift. Der im „Літературно-науковий вісник“ wie auch in der Sammlung verwendete Wortlaut ist mit dem Zusatz versehen; „Оце оповідання в скороченій і менше обробленій формі було написане по-німецьки і надруковане в недільнім додатку до віденської газети ,Die Zeit4, ч. 626 із д. 19 червня 1904.“
Über eine usprünglich andersgeartete Bearbeitung dieses Themas, von der ein erhalten gebliebenes, um einige Jahre älteres Fragment u. d. T. „Хома з серцем. Казка“ (Sign.:
F. 3, Nr. 426) zeugt, vgl. den in Твори, Bd. 4, S. 521 f., wiedergegebenen Text.
30.09.1963