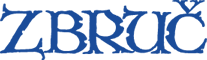Hundert Meter unter der Erde, im dunklen Schachte, arbeitet ein Bergmann. Ein ums andere Mal schwingt er die Haue mit kräftiger Hand, und tief dringt sie in das rissige Gestein. Aber nur mühsam gelingt es dem Manne, dem trotzigen Erz kleine Stücke Erdwachs zu entreißen. Es dröhnt und stöhnt dumpf unter den wuchtigen Schlägen, als ob es weinte und drohte und schwitzt unter widerlichen Gerüchen, hält aber stand und bewahrt trotzig seine verborgenen, geheimen Schätze. Der Bergmann, ein kräftiger Bursch, der erst vor kurzem aus dem Gebirge nach Boryslav zur Arbeit kam, beginnt ordentlich wütend zu werden.
„He, he!“ Mit diesem Ausruf begleitet er jeden seiner kräftigen Schläge, und schon ihrer drei hat er in die kleine Vertiefung geführt, ohne daß es ihm gelungen wäre, auch nur ein Klümpchen Erdwachs zu gewinnen. „Ah, daß dich der Henker! Wie lange denkst du noch mich zu frotzeln? Los!“
Und mit aller Kraft stemmte er die Haue unter das Gestein in der kleinen Höhle, um ein Stück des Felsens abzubröckeln. Endlich gab der Klumpen nach, er erfaßte ihn mit beiden Händen und trug ihn zum Kübel.
„Geh hin, zum Teufel! In die Welt hinaus! Sollst auch wissen, was Sonne heißt!“ sprach er dabei. „Ho — ho, mein Schatzerl! Ich spaße nicht. Laß dich mit mir nicht ein, denn ich versteh’s, auch nicht nur mit einem solchen, wie du einer bist, fertig zu werden. Du weißt nicht, was das heißt, siebenhundert Schafe zu hüten. Das ist keine solche Kleinigkeit, wie ihr Erdklümpchen alle miteinander, und ich bin doch mit ihnen fertig geworden.“ Und er hebt den vollen Kübel empor und trägt ihn zum Aufzug, hängt ihn an das Seil und gibt das Signal zum Hinaufziehen; mit dem leeren Kübel kehrt er in seinen Stollen zurück und fängt wieder an, das Gestein aufzuharken. Seine Gedanken weilen bei den Almen, bei seinen Schafen, und um die Einsamkeit und das Dunkel zu vergessen, spielt er mit diesen Gedanken, erzählt sie dem Lehm, der Hacke und dem leeren Kübel und der Axt — denn das ist seine ganze Gesellschaft in dem tiefen Abgrund.
„Du glaubst wohl, mein Schatzerl, daß siebenhundert Schafe wenig zu tun geben? Ist doch jedes lebendig, und jedes hat seinen Verstand. Zwar ist’s ein gar kleines Gehirnchen — ist’s ja doch ein Tier —, aber immerhin ist’s ein solches, wie es ihm der liebe Gott gegeben. Schau, wenn’s in den Wald geht oder auf die Alm, dann hält sich alles fein beisammen, da rennt nicht eines dorthin und das andere hierher wie das Hornvieh. Immer in Rudeln. H— he!
Und der Bär, dieser Bösewicht, der lauert nur darauf. 0, der ist auch gescheit! Und wie! Er heißt nicht umsonst Meister Petz! Kauert hinter einem Baumstrunk und wartet, bis das ganze Rudel Schafe in die Schlucht gelangt, dann springt er — hops! und hat sie alle gleich wie im Stalle. Und eins nach dem andern erdrosselt er, kein einziges bleibt übrig. Und die armen Dinger mucksen nicht einmal, stecken die Köpfe zusammen und erwarten still ihr Ende! H—he!
Den Stab in der Hand, die Büchse über der Schulter, das Pfeifchen im Gürtel — so ausgerüstet machte ich mich jeden Morgen hinter den Schafen auf den Weg. Drei Hunde waren auch dabei! Einer ging an der Spitze, zu beiden Seiten des Rudels je einer, und ich hinterdrein. Ich ging ganz gemächlich, blieb manchmal stehen. Die Schäfchen zogen ins Grüne wie ein Bienenschwarm. Hier ein weißes Häuflein Schafe, dort ein schwarzes und wieder ein weißes und wieder ein schwarzes Häufchen. Bald hier zupft es ein Grashälmchen aus, bald dort, und immer geht es weiter, immer weiter. Es weidet nicht wie das Vieh, es zupft bloß, wie ein Kind, als ob es spielte und es dabei eilig hätte, weiterzukommen. Und vorn schreiten die Böcke, die Kommandanten. Man muß ihnen nur den Weg weisen, das Rudel folgt schon. A byr-byr! A dria-u!“
Diese Hirtenrufe widerhallen im dunklen Stollen, darein mischt sich das dumpfe Aufschlagen der Hacke.
„Und schön ist’s bei uns in den Bergen, auf der Alm! O wie schön! Nicht wie bei euch, daß euch . . .“
Ein Fluch schwebte schon auf seinen Lippen, aber er schlug sich mit der Hand auf den Mund. Seine Seele weilte jetzt in den Sphären der Poesie, mitten in der lebendigen Natur, die so empfindlich und allsehend ist, und er fürchtete sie zu verletzen, da er in ihrem Banne lag.
„Schön ist’s dort bei uns! Ach Gott! Hab’ ich mich auch genug in Knechtesdiensten aufgerieben, so manche bittere Not ausgestanden, für fremden Vorteil im Schweiße gearbeitet, dennoch tut einem die Erinnerung nicht weh. Da gehst du auf die Alm, es grünt alles um dich her, nur die Disteln* neigen ihre weißen Köpfchen zur Erde und gucken wie neugierige Augen aus dem Grase und Moose hervor. Es ist kühl. Es weht der Wind. Du atmest frei und tief mit voller Brust. Alles duftet um dich her, atmet dich an mit Gesundheit und Kraft. Unten umgürtet der Wald gleich wie mit schwarzer Wand die grüne Alm, und über dir erhebt sich die runde Kuppel des Berges. Und still ist’s ringsum, nur die Schafe rascheln im Farnkraut, hie und da bellt ein Hund auf, der Grünspecht läßt sein Klopfen im Walde hören, oder ein Eichhörnchen quiekst auf. Und ich wandle gemächlich herum, bleibe stehen, ziehe das Pfeifchen aus dem Gürtel heraus, und dann lass’ ich ein Liedchen erschallen, gar fein, so lustig hüpfend, dann eine gar so traurige Dumka, daß dabei das Herz in der Brust einem mithüpft oder die Augen sich mit Tränen füllen. H-he! Pfui über dich! Laß los! H—he!“
Es ertönt das Klingelzeichen. Der leere Kübel ist angelangt. Der Mann nimmt seinen vollen, trägt ihn in den Schacht, und während dieser hinaufbefördert wird, kehrt er mit dem leeren zurück. Er befindet sich nunmehr in kriegerischer Laune, denn er beginnt schon hungrig zu werden. Wütend schlägt er mit der Hacke darauf los, zerbröckelt den Lehm, und in Gedanken kämpft er mit dem Bären.
- „Ho-ho! Meister Petz! So geht’s nicht weiter! Ein Schaf — das scheint nicht viel; aber heut hast du mir bloß ein Schaf zerrissen, morgen wirst du mir zwei zerreißen, und übermorgen erdrosselst du mir am Ende das halbe Rudel. Nein, Schatzerl! So haben wir nicht miteinander gerechnet. Du glaubst, daß ich die Büchse bloß zum Schreckeneinjagen mit mir herumtrage? Ho, ho! Eine Nacht werd’ ich schon opfern und mich in dieser Schlucht auf die Lauer legen. Ist mir egal, leben oder sterben, mit dir aber muß ich die Angelegenheit zu Ende führen!“ Er schlägt noch einigemal mit der Hacke an, dann hält er inne, auf ihren Griff gestützt ruht er aus.
„Der Dieb, der Räuber! Drei Nächte lang hat er mich gequält. Wahrscheinlich hat er den Braten gerochen und ließ sich nicht blicken. Aber ich lass’ mich nicht foppen. Wenn ich mir was vorgenommen, da lass’ ich davon nimmer. In der vierten Nacht ist er doch gekommen. Finster ist’s, daß man die Hand nicht vor den Augen sehen kann. Der Wind streicht über die Wipfel der Tannen. Unten rauscht der Bach, und ich, zwischen den Baumwurzeln in der Schlucht hockend, lauere und horche, die Büchse am Auge. Schon hör’ ich seine Tritte, weiß, daß er an mir Vorbeigehen muß, ich warte unbeweglich, mit angehaltenem Atem. Es knacken die dürren Äste — er ist ganz nah. Ich reiße die Augen mächtig auf — da wankt mein Isegrim heran, wie ein Heuhaufen in der Finsternis anzuschauen. Das Maul erhoben, schnuppernd nähert er sich ganz langsam, vorsichtig. Mir treten beinah die Augen aus den Höhlen, so scharf schau’ ich nach ihm hin, um ihn genau unter das linke Schulterblatt zu treffen. Plötzlich bleibt er stehen, wendet den Kopf zur Seite und stößt ein kurzes Gebrumm aus. Er roch das Pulver. Auf der Stelle macht er kehrt, um die Flucht zu ergreifen, und in diesem Augenblick — piff-paff! Aus beiden Läufen der Büchse applizierte ich ihm je eine volle Ladung in den Pelz. Meister Petz hatte wohl kaum Zeit mit der Wimper zu zucken, da stürzte er wie vom Blitz getroffen zu Boden. Aber es währte bloß einen Moment. Im nächsten sprang er auf, stieß ein schreckliches Gebrüll aus, erhob sich auf die Hinterbeine und drang gerade auf mich ein. Offenbar traf ihn der Schuß nicht ins Herz. Ich bleibe regungslos, auf alles gefaßt. Zur Flucht ist der Weg verlegt, die Büchse wieder zu laden — keine Zeit. Na, denk’ ich mir, wenn ich ihn schlecht getroffen, bloß geritzt, dann wird’s wohl mit mir bald aus sein. Übrigens Gottes Wille geschehe. Einmal wird der Mensch geboren. Vorläufig hab’ ich noch eine Axt im Gürtel. Da spuckte ich in die Hände, riß die Axt heraus, bekreuzte mich, fand einen festeren Stand mit den Füßen an den beiden Baumwurzeln, lehnte mich an die durcheinanderwachsenden Wurzeln, die förmlich wie eine Wand sich hinter mir erhob«, biß die Zähne zusammen, senkte den Kopf, um schärfer zu sehen, und erwartete den Bären. Und er ist schon ganz nah. Erfaßt mit den Tatzen die Wurzeln, wittert und brüllt, brüllt wie ein wütender Trunkenbold, der nicht imstande ist, ein vernünftiges Wort hervorzubringen, nur die Empfindung hat, daß er wütend ist, brüllt und dringt vorwärts. Da hat er meinen Fuß gerochen und langt schon nach ihm mit der Tatze. Es war, als hätt’ er mich mit der Brennessel berührt — nichts weiter. Und in diesem Augenblick drang auch meine Axt bis ans Holz in Meister Petzens Schädel und zerschmetterte ihn buchstäblich gänzlich. Er stöhnte noch einmal auf, so schwer, so mitleiderregend wie eine sündige Seele in der Höllenqual, stürzte und verschwand in der undurchdringlichen Finsternis in einer Bodensenkung unter dem Abhang. Ich hatte nicht einmal Zeit gefunden, meine Axt herauszuziehen, mit ihm zusammen kollerte sie auch herab. Da aber machte ich mich auf die Beine, fort ging es durchs Gestrüpp, über den Fußpfad, durch den Wald, über die Halde, an den Schluchten und Abhängen entlang, im Handumdrehen befand ich mich auf der Alm bei der Baude. Ich klopfe an. ,Bist du es, Pańku?‘ fragt mich der Senne von innen. ,Ich bin’s, öffnet nur' Er erhob sich, zündete eine Laterne an, öffnete die Tür. ,Nun?‘ — ,Nichts besonderes‘, sag’ ich. ,War der Bär da?‘ — ,Wohl war er daß— ,Und ist weg?‘ — ,Nein, er ist nicht weg.‘ — ,Was denn?‘ — ,Er liegt.‘ — ,Was — du‘, dem Sennen blieb das Wort im Munde stecken. ,Du lieber Himmel, was ist mit deinem Bein geschehen?‘ rief er aus. ,Mein Bein?‘ — das wußte ich selber nicht, und erst jetzt sah ich, daß der ganze Schuh und der Fußlappen und alle Bänder blutig waren und blutige Spuren zurückließen. Nur einmal, ein einziges Mal hat der Bär mit seiner Kralle meinen Fuß berührt und auf einmal den Schuh, die Lappen und den Fuß bis an den Knochen zerrissen. Als man mir den Fuß entkleidete, bin ich ohnmächtig geworden, ich hatte zuviel Blut verloren. Aber der Senne, Gott vergelte es ihm, verstand das Blut zu besprechen, es hörte auf zu sickern; er legte eine Salbe an, und in einer Woche war ich schon gesund. Und den Bären fand man nächsten Tages tot, mit meiner Axt im Schädel.“
Wieder ertönt das Klingelzeichen, und der Mann schleppt mühsam den von Erdwachs vollen Kübel zum Schacht und bringt den neuen, und weiterhackend unterhält er sich mit sich selber, erfüllt den unterirdischen Gang nicht nur mit dem Geräusch von den Schlägen seiner Hacke, sondern auch mit seiner Stimme, mit der Poesie seiner Wälder und Almen. Im gleichen Maße wie er hungriger und schwächer durch die Ermüdung und Dumpfigkeit wird, werden auch seine Gedanken immer trauriger. Er erinnert sich an das schwere Leben des Schafhirten im Winter, an den Haferbrei, Kartoffeln und Maisgrütze, die seine Nahrung im Winter bilden, an das langweilige Dreschen und die noch langweiligere Untätigkeit während der großen Fastenzeit, an die schwere „Zwischenbrotzeit“, die Krankheiten und Zänkereien wegen eines Stückchens Brot oder halbgarer Kartoffel. Er erinnert sich, wie jetzt der Hirtenstand immer mehr herabkommt dadurch, daß die Juden in ihren Besitz die Almen gebracht, wodurch es vorteilhafter ist, Ochsen zu mästen, mehr als Schafe. Und der Dienst bei den Ochsen ist ein anderer. Ein schwerer, unleidlicher Dienst! Hier bekommst du keine Molke zu kosten, keinen Käse, weder Brimsen noch Banusch*! Selbst wie ein Hund, und mußt dich wie ein Hund ernähren. Und er hat nicht lang in diesem Dienst ausgehalten, schenkte einem Freunde Gehör, der ihm riet, nach Boryslav zu gehen, Geld erwerben, dann in einen Hof einzuheiraten (mit Geld wird man jetzt überall gerne angenommen) und ordentlich die Wirtschaft zu führen. Und er erinnerte sich sogar an das Liedchen, welches ihn der Freund gelehrt:
„Auf will ich nach Boryslawka*,
Um Geld zu erwerben.
Komm’ ich dann von dort zurück,
Ein Wirt will ich werden.“
Er stimmte das Lied an mit seiner kräftigen Hirtenstimme, aber nein, es ging nicht. Mochte es sein wie ihm wolle* aber im Stollen, hundert Meter unter der Erde, wollte das Lied nicht aus der Kehle.
Und ärgerlich gräbt er weiter. Er fängt an, diese Erde zu hassen, diese dunkle, schwere, unbarmherzig harte Erde, die solch einen verzweifelten Widerstand seiner Hacke entgegenstellt.
„Aber hart bist du, du heilige!“ sagt er, „und Gott mag wissen, ob du heilig bist oder nicht! “
Und er hält inne, riсhtet sich auf und beginnt über diese Frage nachzugrübeln, als ob sie Gott weiß wie wichtig wäre.
„Nein, wahrhaftig, ist sie hier heilig? Dort oben — das ist sicher. Das Wasser wird geweiht und besprengt, und das Wort Gottes wird über ihr gepredigt. Aber hier? Seit die Welt steht, drang doch bis hieher sicherlich kein Tröpflein geweihten Wassers, auch nicht ein einziges Wort des Evangeliums. Deshalb herrscht hier auch solch ein Gestank. Das kommt sicherlich von keiner Heiligkeit, sondern im Gegenteil vom Bösen. Dürfen doch aus diesem Wachs keine Kerzen für die Kirche hergestellt werden, offenbar ist das ein Unrat, ein Schmutz! Gott verzeih mir die Sünde! Der Mensch kriecht auch in so einem Pfuhl herum und nimmt das unreine Gut. Und das soll ihm zum Guten gereichen? Ach nein, meine Verehrtesten, nein! Das kann einem doch nicht wohl bekommen! Und der Freund, der mich hieher gewiesen, ist er etwa nicht in eben einem solchen Stollen zugrunde gegangen? Es hat ihn verschüttet, man hat sogar seine Leiche nicht herauf holen können. Der Teufel hat ihn verschluckt. Ach du lieber Gott! Und er bekreuzt sich und fährt fort, noch fleißiger zu hacken. Nach dem Knurren und Kollern in seinem Magen merkt er, daß es bald Mittagszeit sein müsse und erwartet das dreifache Klingelzeichen, den Augenblick, wo ihm geheißen wird, hinaufzukommen. Unterdessen aber arbeitet unaufhörlich auch seine Einbildungskraft, zaubert ihm immer neue Bilder vor, am meisten die wundervollen, stillen und hellen Bilder der Alm, der Wälder, der Rudel Schafe und aller imgekünstelten Abenteuer des Schäferlebens. Vom Schicksal in den tiefen, undterirdischen Schacht verschlagen, fühlte er in seinem Herzen die Gewißheit, daß jene Tage unwiederbringlich vergangen, daß sein Fuß einen neuen Lebenspfad betreten, und er nach dem früheren patriarchalischen Leben ein neues beginne, welches seinen Vätern und Großvätern unbekannt, anfangs ein schreckliches und wunderliches, in mancher Hinsicht aber viel freieres und mit weiterem Wirkungskreise als das alte Leben. Aber das Vergangene lebt in seinen Erinnerungen; es blieb davon noch so viel übrig, um mit poetischem Zauber die Finsternis des neuen Lebens zu erhellen, die Einsamkeit desselben zu beleben. So wird auch die Sonne manchmal von einer Wolke beschattet, und von der ganzen Herrlichkeit des Sommertages, von allem Reichtum und Pracht der leuchtenden Strahlen und Farben bleibt nur so viel, um mit goldenem Schein die Ränder der schweren Wolken, die über dem Sonnenuntergang schweben, zu umfluten.
________________
* Im ukr. Text ist von „головатні“ die Rede, von sehr niedrigen Bergdisteln, deren faustgroße Blüten gerade über die Erde ragen
* Art Polenta mit Butter und Brimsen gebraten (Amn. Frankos)
*Boryslawka — gleichbedeutend mit dem Ort Boryslav, dem ältesten Zentrum der Naphta- . und Ozokeritindustrie im Vorkarpatengebiet
=====================================
Erstveröffentlichung dieser Erzählung (ukr. Titel „Вівчар“) in der Sammlung „Полуйка й інші бориславські оповідання“ (Lemberg 1899); später wurde sie in die Sammlung „Бориславські оповідання“ (Kiew 1905) aufgenommen. Der in Твори, Bd. 4, Kiew 1950, S. 24—28, wiedergegebene Text folgt der Erstveröffentlichung. Der vorliegenden deutschen Fassung liegt in unveränderter Form der in der „Ukrainischen Rundschau. Monatsschrift“ (Jg. 5, Wien 1907, S. 27—33) veröffentlichte Text zugrunde. Vgl. auch Franko, Життя і творчість, S. 266.
30.09.1907